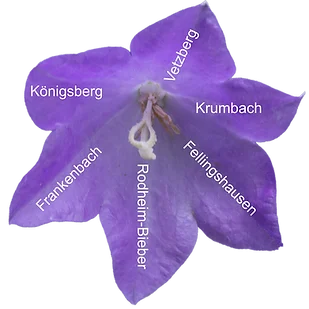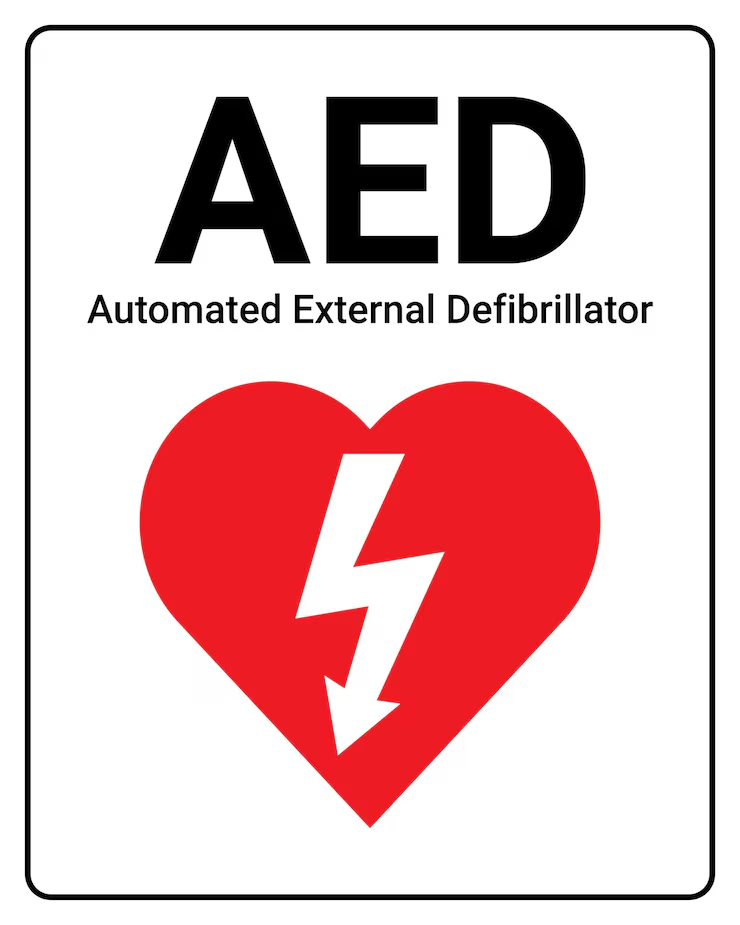Fühlen sich Menschen krank, greifen heutzutage immer mehr Menschen zunächst zum Smartphone, bevor sie einen Arzt konsultieren.
Die Begriffe „Dr. Google“ und „Dr. KI“ stehen sinnbildlich für diesen Wandel.
* Morbus ist das lateinische Wort für Krankheit.
*Google ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das vor allem durch die gleichnamige Suchmaschine Google bekannt wurde. Damit lässt sich nach Internetseiten zu allen möglichen Themen suchen.
* KI ist die Abkürzung von „künstlicher Intelligenz“ oder englisch AI „artificial intelligence“. Sie ist ein Teilgebiet der Informatik, die sich u.a. mit Automatisierung und maschinellem Lernen befasst, wobei die Bezeichnung „Intelligenz“ eine werbewirksame Übertreibung ist.
* „Dr. Google“ bezeichnet die eigenständige Internetrecherche nach Symptomen, Diagnosen oder Therapien mithilfe von Suchmaschinen.
* „Dr. KI“ steht für den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur medizinischen Beratung und Entscheidungsunterstützung.
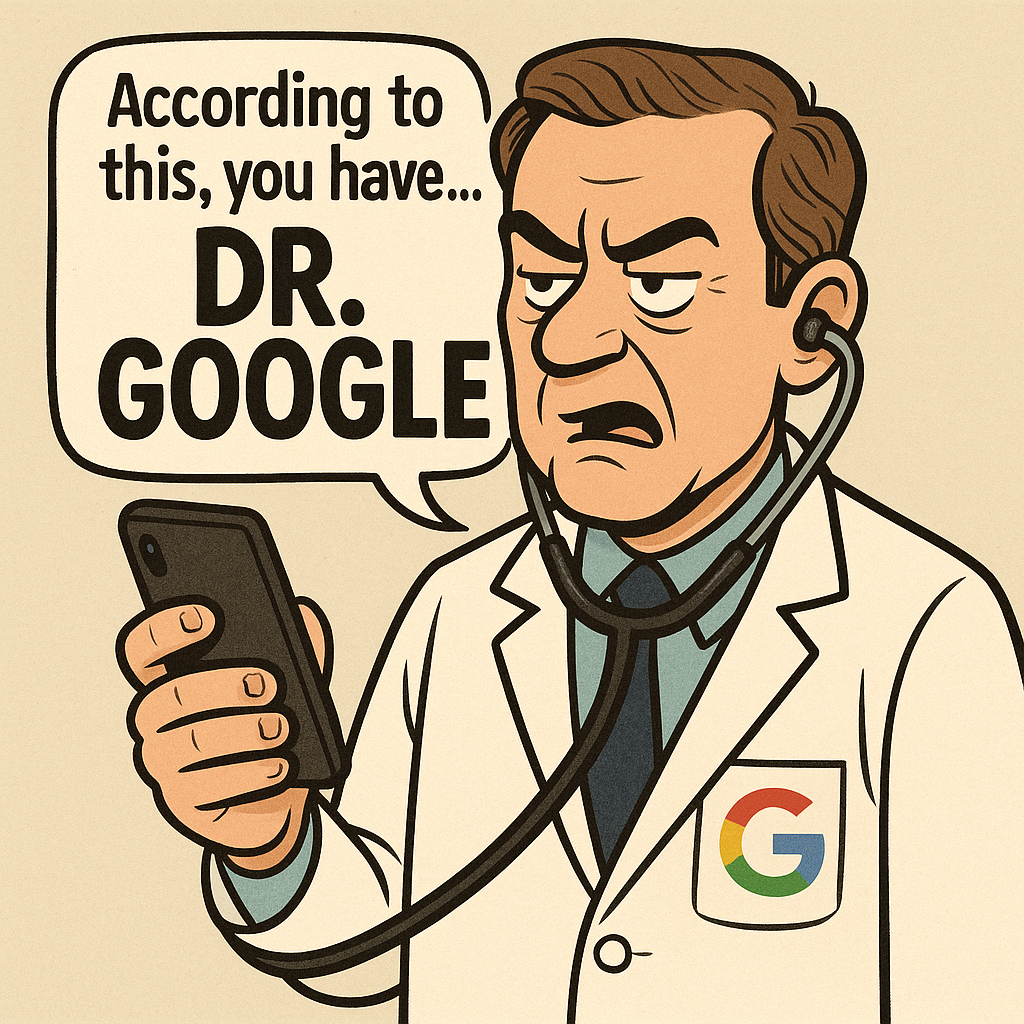
Die Menschen suchen im Netz, also im Internet; meist mit einer Google-Suche oder inzwischen mit Hilfe von KI-Systemen, was ihre Symptomatik bedeuten könnte. Sie versuchen also, sich selbst eine Diagnose* zu ihrem Befinden zu stellen – allerdings, und das ist das Problem, ohne inhaltlich abschätzen zu können, wie relevant die von den Chatbots* angebotenen Krankheitsbilder für sie sind.
* Das Wort Diagnose (bestehend aus diá-: ‚durch-‘ und gnósis,: ‚Erkenntnis‘, ‚Urteil‘) ist vom altgriechischen diágnosis abgeleitet und bedeutet ‚Unterscheidung‘, ‚Entscheidung‘ und bleibt innerhalb des ärztlichen Denkens eine Arbeitshypothese (von hypóthesis: ‚Unterstellung‘), die weiter überprüft und im Prozess gesichert werden muss. Sie ist ein wichtiges Hilfsmittel bei Entscheidungen für eine bestimmte Therapie.
* Ein Chatbot ist ein textbasiertes Dialogsystem, das Chatten (Chat, englisch: plaudern, sich unterhalten) mit einem technischen System erlaubt.
Unter einem Bot (vom englischen robot: Roboter) versteht man ein Computerprogramm, das weitgehend automatisch sich wiederholende Aufgaben abarbeitet, ohne dabei auf eine Interaktion mit einem menschlichen Benutzer angewiesen zu sein.
Denn ohne medizinisches Hintergrundwissen, ohne weitere zugehörige Befunde, Informationen, abzugleichende Differentialdiagnosen und ohne Quellenangaben für die Rechercheergebnisse kann kaum beurteilt werden, ob die Suchergebnisse für den eigenen Fall passend sind. Denn die im Netzt gefundenen, nach vorne gestellten Ergebnisse müssen in keiner Weise statistischen Wahrscheinlichkeiten entsprechen oder auf die fragende Person zutreffen. Also können die eruierten Suchergebnisse nützlich sein; sie können aber auch verunsichern oder gar schaden. Dies insbesondere, wenn Menschen nach der Internetrecherche überzeugt sind, dass harmlose Symptome auf eine lebensgefährliche Erkrankung hinweisen.
Diese Gefahr wird mit der KI-Suche zwar geringer, da KI-Antworten differenzierter sind und auf die ärztliche Expertise verweisen. Dabei motiviert die KI die Nutzerinnen und Nutzer auch dazu, bei kleinsten Symptomen sofort den Arzt oder die Notaufnahme aufzusuchen. Andererseits werden sich Menschen auch mit KI-Antworten zufrieden geben, wo ein Arztbesuch sinnvoll – und manchmal lebensrettend – wäre.
Kommt also jemand mit einer vorgefassten, von Google oder KI-Chatbots angebotenen, „Diagnose“ zum Arzt, so gilt das dort zunächst einmal als ein „Morbus Google“ oder als ein „Morbus KI“. Sinn- und sorgfältiger Weise müssen Ärzte sich ein eigenes Bild machen, um zu sagen, das passt oder überhaupt nicht passt von dem, was die Patientin oder der Patient an Erwartung und „Diagnose“ mitgebracht hat.
Zum Teil bleiben manche Patienten, trotz des ärztlichen Expertenwissens, an ihrem vorgefassten Meinungsbild kleben und glauben, die Maschine könne sich nicht irren und der Arzt habe etwas übersehen, wenn er nicht zu der erwarteten „Morbus Google“-Diagnose kommt.
Wir sollten es kommerziellen Suchmaschinenanbietern mit ihrer marktbeherrschenden Stellung, ebenso wie Lifetrackern in Smartwatches z.B., nicht überlassen, Aussagen über unsere Gesundheit zu treffen. Ihre Qualitätsversprechen sind, zumindest zur Zeit, noch wenig verlässlich. „Man sollte KI-Antworten ohne weitere Prüfung genauso wenig trauen wie anderen Gesundheitsinformationen im Netz“, sacht Klaus Koch Chefredakteur von gesundheitsinformation.de. So ist es im Dt. Ärzteblatt, Jg. 122, Heft 14 vom 11.07.2025, A828-830 zu lesen.
„Dr. Google“ und „Dr. KI“ – Zwischen hilfreicher Information und gefährlicher Fehldiagnose
✅ Die Vorteile von Dr. Google & Dr. KI
- Schneller Zugang zu Informationen
Nutzer können innerhalb weniger Sekunden Informationen zu Symptomen, Medikamenten oder Behandlungen abrufen – rund um die Uhr, ohne Wartezeit. - Besseres Verständnis und Vorbereitung
Vor einem Arztbesuch hilft die Recherche, Fragen gezielter zu stellen und besser zu verstehen, was im eigenen Körper passiert. - Früherkennung & Sensibilisierung
In manchen Fällen kann die Suche nach Symptomen auf ernsthafte Krankheiten hinweisen, die sonst vielleicht ignoriert worden wären. - Digitale Tools mit KI-Unterstützung
Intelligente Diagnose-Apps analysieren Symptome mit Hilfe großer Datenmengen und können erste Hinweise geben – teilweise genauer als ein menschlicher Laie.
⚠️ Die Gefahren von Dr. Google & Dr. KI
- Fehlinformation und Panikmache
Nicht alle Quellen im Internet sind zuverlässig. Harmloses Bauchweh wird schnell zur „vermuteten Krebserkrankung“, wenn man tief genug gräbt. Das führt häufig zu unnötiger Sorge. - Selbstdiagnose statt Arztbesuch
Wer sich zu sehr auf Online-Informationen verlässt, verzichtet womöglich auf den Gang zum Arzt – und riskiert damit eine Fehldiagnose oder verspätete Behandlung. - Informationsüberflutung (Overload)
Laien können kaum beurteilen, welche Quelle seriös ist oder welche Diagnose wahrscheinlich ist – besonders bei komplexen Symptomen. - Fehlende Kontextkenntnis bei KI-Systemen
Künstliche Intelligenz kann Symptome nicht im Gesamtkontext bewerten: familiäre Vorerkrankungen, psychische Faktoren oder subtile Hinweise gehen oft verloren.
📌 Fazit
Hilfreich als Ergänzung, nicht als Ersatz für ärztliche Beratung.
Informieren: Ja. Diagnostizieren & Therapieren: Bitte dem Arzt überlassen!
Bild und unterer Textteil wurden mit ChatGPT erstellt